Ralf Bokermann
Kleinstädte als Anker ländlicher Entwicklung
- Kurzgefasste Ergebnisse des Projektes/Buches "Kleinstädte in ländlichen Räumen" -
1. Einführung: Skizzierung des ländlichen Raumes
1.1 Differenzierende Merkmale: Große Vielfalt ländlicher Räume ► Vielfalt an Naturräumen ♦ Vielfalt der wirtschaftlichen Bedingungen (Kernzonen, Peripherräume, Mittellagen) ♦ Vielfalt des Kulturerbes, aber durch diese Vielfalt vermutlich bedeutendste Standorte des Kulturerbes, vor allem der Baukultur.
1.2 Ähnliche Merkmale: Freiräume (Kulturlandschaften) überwiegen gegenüber Siedlungsflächen ♦ Vorherrschend kleinere Siedlungen als Dörfer/Weiler ♦ Relativ geringe Einwohnerdichte.
1.3 Abgrenzung für Deutschland nach der Gemeindegröße: Gemeinden bis 20 Tsd. Einwohner ► ländlcher Raum (Untergrenze).
Einwohner Fläche Einwohnerdichte
a) Gemeinden Mill. km2 je km2
insgesamt: 82.44 357,05 231
v.H. 100% 100% 100%
b) Gemeinden bis
20 Tsd. Einw.: 34.55 293,57 118
v.H. 42% 82% 51%
c) Anteil/ Bruttowertschöpfung: ca. 37%
Quelle: Statistisches Jahrbuch f. Deutschland, 2007
n
 |
Abb.1: Stadt Scheinfeld (West- Mittelfranken) mit zugeordneten Ortschaften
2. Rolle und Funktionen von Kleinstädten
2.1 Wesentliche Funktion: ► Kleinstädte sind im Regelfall die Mittelpunkte ländlicher Kleinregionen ♦ In Deutschland spannt sich ein Netz dieser kleinen Zentren über den ländlichen Raum ♦ Dieses Netz ist als Anker für die Sicherung ländlicher Regionen anzusehen.
2.2 Typische Raumstruktur: ►Mittelpunkte ländlicher Kleinregionen von ca. 7 - 15 Ortschaften ♦ Beispiele typischer Raumstruktur:
► Scheinfeld/ Mittelfranken (Abb.1): 13 Ortschaften, 4736 Einwohner, davon 2746 (58%) in der Stadt Scheinfeld.
► Sternberg/ Westmecklenburg (Abb.2): 10 Ortschaften, 4490 Einwohner, davon 3100 (69%) in der Stadt.
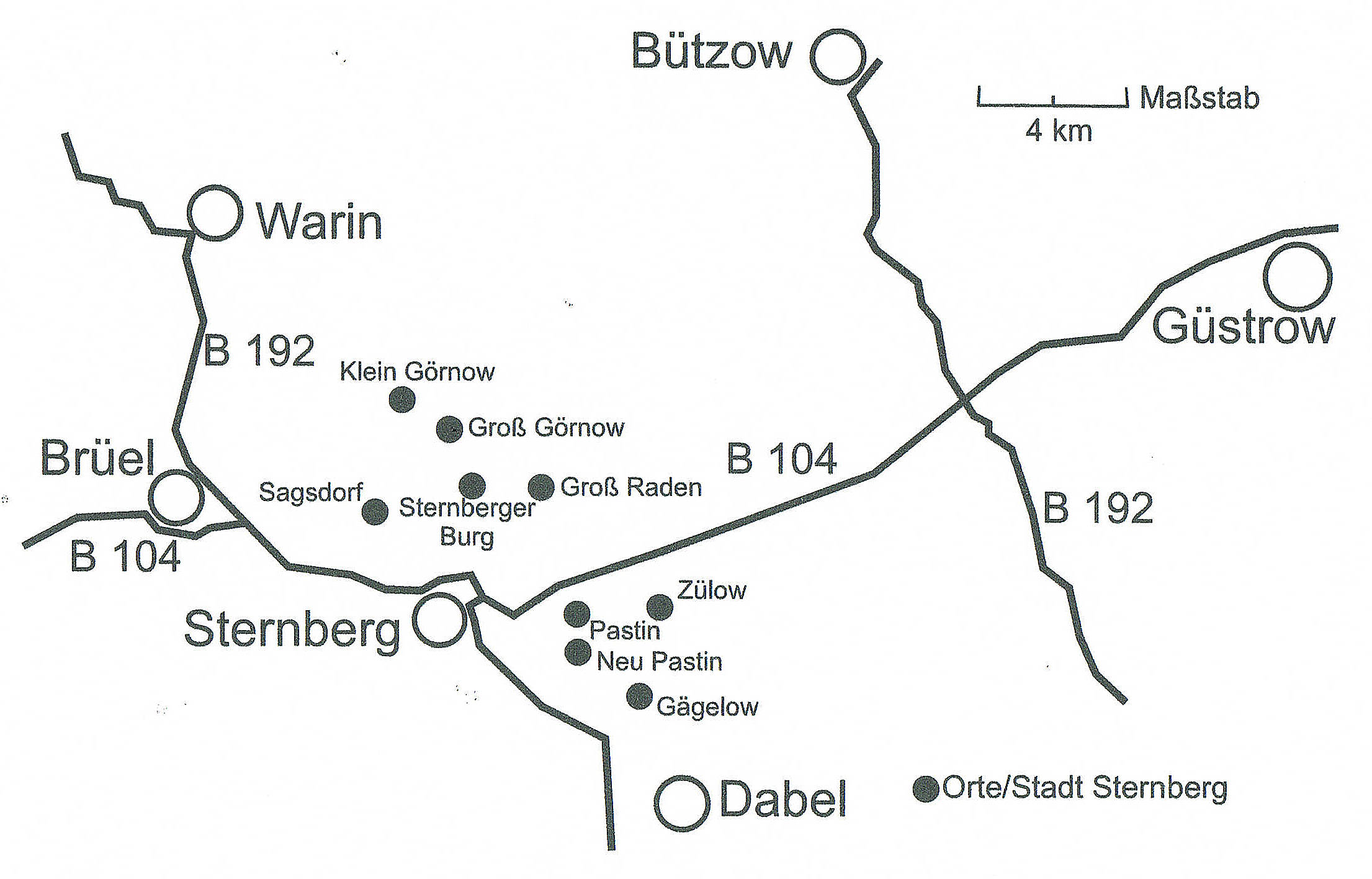 |
Abb.2: Stadt Sternberg mit zugehörigen Ortschaften
2.3 Typische Funktionen für ländliche Kleinregionen: ► Mittelpunkte für: ♦ Überwiegenden Wohnort der Bevölkerung ♦ Beschäftigung der Erwerbstätigen (Beispiele: Scheinfeld für 70%, Sternberg für 77% der Beschäftigten vor Ort) ♦ Erzielung des größten Teiles der Wertschöpfung/ Wirtschaftskraft ♦ Allgemein bildende Schulen ♦ Kommunale Verwaltung ♦ Versorgungsstrukturen, z. B. Gesundheitspraxen, Einzelhandel (Fachhandel nur noch bedingt), Banken ♦ Soziale Einrichtungen: Kinder- , Jugend- , Seniorenbetreuung ♦ Soziales Leben: Veranstaltungen der Bereiche Kultur, Unterhaltung, Sport, Freizeit.
2.4 Weitere Merkmale von Kleinstädten: ► Hoher Grad an ehrenamtlichen Initiativen/ bürgerschaftlichem Engagement, z. B. ♦ bei Betreuungsaufgaben, Ausrichtung öffentlicher Veranstaltungen, Stadtmarketing, Förderung des Tourismus, Stadtentwicklung, Erhaltung des Kulturerbes ♦ Hohes Maß an Sozialkapital: Relativ hoher Anteil der Einwohner initiativ in sozialen/ kirchlichen Gruppen, Vereinen, Initiativen, gemeinschaftlichen Aufgaben ♦ Abhängigkeit von wirtschaftlichen Kernzonen besteht vor allem durch sehr hohen Anteil von Auspendlern ♦ Wahrnehmung in der Gesamt- Gesellschaft: Defizit an öffentlicher Wahrnehmung für Stärken und Probleme von kleinen Städten.
2.5 Probleme von Kleinstädten als ländliche Mittelpunkte: ♦ Verlust von Funktionen an größere Zentren (Abzug vor allem von öffentlicher Infrastruktur) ♦ Häufig nennenswerter Verlust von Arbeitsplätzen (= Wirtschaftskraft), besonders im produzierenden Gewerbe.
► Mit wesentlichen Folgeproblemen für Kleinstädte: ♦ Tendenz zur Abwanderung → rückläufige Bevölkerung ♦ Verengung des Wirtschaftskreislaufes ♦ Geringere Finanzkraft der Gemeinden ♦ Leerstand von Geschäftsräumen/ Wohnungen ♦ Rückläufige Auslastung der Infrastruktur.
3. Sicherung der Funktionen kleiner Städte/ ländlicher Kleinregionen ( Teilstrategie zur Stärkung ländlicher Regionen)
3.1 Auf staatlicher Ebene: ♦ Keine Schlechterstellung in Planungen zur Raumordnung/ bei öffentlicher Förderung (Beispiele: Berlin- Brandenburg für geringe, Bayern für deutliche Aufmerksamkeit) ♦ Kein Abzug öffentlicher Einrichtungen nach pauschalen Kriterien, sondern möglichst Weiterführung in verkleinerter Form mit angepassten Konzepten, vor allem bei ►Schulen, öffentlichen Dienstleistungen, Gesundheitsdiensten.
3.2 Sicherung von Funktionen auf kommunaler Ebene: ♦ Interkommunale Zusammenarbeit in allen Bereichen ►bei Ver- und Entsorgungsanlagen, der Verwaltung, gemeinsamen Gewerbegebieten, Erwachsenenbildung, Tourismusförderung, Stadtentwicklung ♦ Dauerhafte Bemühungen um gewerbliche Betriebe der Stadt ► Bestehende Betriebe haben Vorrang für Neuansiedlungen ► Bemühungen um Unternehmen in internes Stadtmarketing integrieren ♦ Förderung des ehrenamtlichen Engagements bei ► öffentlichen Veranstaltungen (u. a. Kultur, Unterhaltung, Sport), Tourismusförderung, Stadtmarketing.
3.3 Interne Stärkung kommunaler Funktionen: ♦ Erweiterung des Stadtmarketing auf ein Innenmarketing als generelles Organisationsprinzip ► Einbindung von Unternehmen, Vereinen u. Bürgergruppen in das Zielsystem der Stadt ♦ Verankerung einer dauerhaften Motivierungs- und Innovationsbereitschaft über das interne Stadtmarketing bei allen beteiligten Gruppen ► Unternehmen, Vereinigungen, Bürgergruppen.

